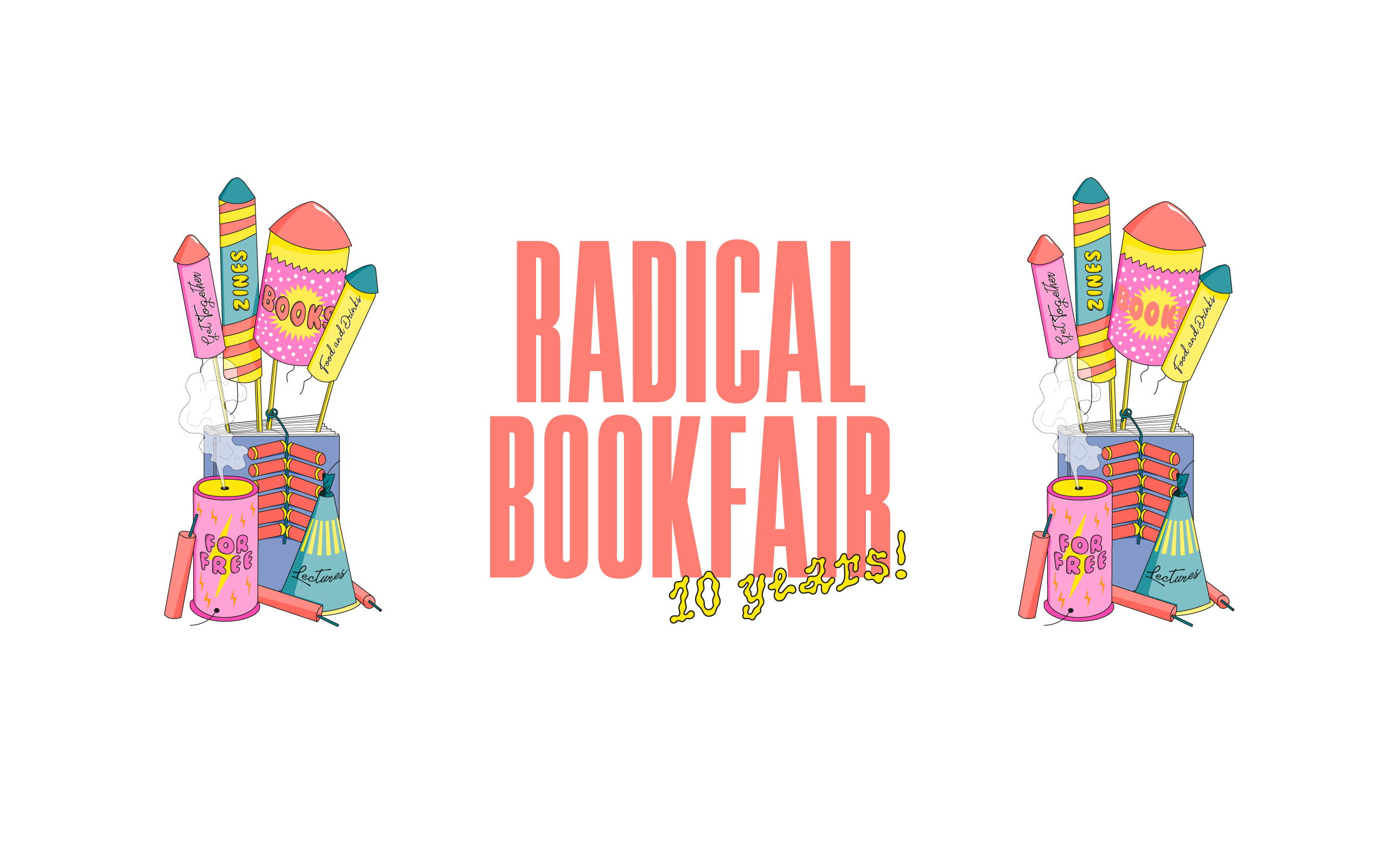SAMSTAG
13:00
»Memorandum des Diwans. Tagebuch eines Freiheitskämpfers«
Im Schatten des Terrors und der Unterdrückung erzählt Karwan Rauf Hama Amin seine bewegende Geschichte als kurdischer Widerstandskämpfer im Nordirak der 1980er Jahre. Inmitten eines brutalen Kampfes gegen das Regime von Saddam Hussein wird er gefangen genommen. Drei Jahre lang ist er in den berüchtigten Gefängnissen inhaftiert, gezeichnet von harter Haft, Folter und einem täglichen Ringen um Würde und Hoffnung. Mit eindringlicher Ehrlichkeit schildert er sehr explizit den erbarmungslosen Überlebenskampf hinter den Gefängnismauern und die stille Solidarität, die ihn und seine Mitgefangenen trotz unerträglicher Qualen verbindet.
Dieses Buch ist ein Zeugnis von Widerstand, dem Streben nach Freiheit und ein Mahnmal gegen das Vergessen.
Bela Winkens: „Brief an die Mutter“ – Lesung mit Alex Bachler und Bettina Wilpert, moderiert von Jörg Sundermeier
In »Brief an die Mutter« schreibt Bela Winkens an ihre Mutter, die im KZ Auschwitz ermordet wurde und die sie nie wirklich kennenlernen konnte. Sie erzählt ihr von ihrer Kindheit, ihren Erinnerungen an das KZ Theresienstadt, das sie als Vierjährige überlebte, und wie sie als Überlebende mit dem Schmerz und der Trauer im Laufe ihres Lebens umzugehen gelernt hat.
Geboren wurde Bela Winkens in Berlin am 5. Februar 1941 als Bela Heymann. Ihre Großeltern und Eltern wurden 1942 bzw. 1943 in KZs deportiert und ermordet. Zuvor kam sie durch ihren Großvater zu Verwandten ins Ruhrgebiet und im Juni 1943 wurde sie in Bochum in einem katholischen Kinderheim untergebracht. Das Heim wurde in der folgenden Nacht bombardiert, die vermutlich anonyme Bela mit den anderen Kindern evakuiert. So blieb sie als »Elisabeth« in Nordhessen, ihre Identität flog dennoch auf, sie wurde ins Jüdische Krankenhaus in Berlin gebracht, von dort nach Theresienstadt deportiert. 1946 nahm ein Ehepaar sie in Düsseldorf auf und adoptierte sie.
15:00
»Zeit abschaffen. Ein hauntologischer Essay gegen die Arbeit, die Familie und die Herrschaft der Zeit« · Simon Nagy
Es ist 175 Jahre her, dass es erstmals beim Namen genannt wurde: das die Gegenwart heimsuchende, aus der Zukunft flüsternde Gespenst des Kommunismus. In den letzten Jahren tauchen wieder vermehrt solche Gespenster auf, die von radikal anderen Zukünften zu flüstern wissen. Sie erscheinen vor allem in Filmen, Romanen und künstlerischen Arbeiten, sind aber gar nicht so leicht zu erkennen, weil sie sich nicht an althergebrachte Formen des Spuks halten. Es braucht neue Werkzeuge, um sie aufzuspüren, mit ihnen ins Gespräch zu treten und herauszufinden, was sie uns über unsere Zeit, ihre Abschaffung und von möglichen anderen Zeiten berichten können.
»Zeit abschaffen« tritt mit Gespenstern der Gegenwart und der jüngsten Vergangenheit in einen Dialog. Er sucht das Gespräch mit ihnen mit dem Ziel, ihr Flüstern nicht wie so oft als Drohung, sondern als Versprechen hörbar zu machen. Das Ende der Arbeit, die Aufhebung der Familie und die Abschaffung der Zeit treten dabei als verwandte, einander sogar bedingende Begehren auf. Sie alle drehen sich um das Ziel, der künstlichen Produktion von Gegenwart ein Ende zu setzen und vergangene Kämpfe in kollektiv bestimmte Zukünfte zu transformieren.
„Das Ende der Frauenrechte in Afghanistan. Geflüchtete Frauen berichten“. – Sur Esrafil
Das Buch schildert die bewegenden Schicksale afghanischer Frauen nach dem Machtantritt der Taliban und dem Zusammenbruch des von der NATO unterstützten Regierungssystems. Es beleuchtet die Herausforderungen und die Angst, die die afghanische Gesellschaft ergriff, insbesondere die Frauen, die unter den repressiven religiösen Regeln am meisten zu leiden haben. Diese Frauen, darunter Lohnarbeitende, Journalistinnen und politisch Aktive, sahen sich gezwungen, nach Wegen zu suchen, um der drohenden Gewalt und Unterdrückung zu entkommen.
Das Ende der Frauenrechte in Afghanistan. Geflüchtete Frauen berichten gibt Frauen eine Stimme und archiviert somit die aus ökonomischer, politischer und sozialer Perspektive erlebten Ereignisse. Es gibt einen tiefen Einblick in den Kampf dieser Frauen gegen Korruption und Polarisierung und zeigt ihren Mut und ihre Entschlossenheit, trotz neuer Bedrohungen und Herausforderungen ein freies Leben zu suchen. Indem es persönliche Erinnerungen und Erfahrungen verwebt, wirft das Buch ein grelles Licht auf die zwanzigjährige Anwesenheit der NATO in Afghanistan und die daraus resultierenden langfristigen Auswirkungen auf die Gesellschaft.
Sur Esrafil studierte an der Universität Herat und war viele Jahre als Anwältin in Afghanistan tätig. Sie war Mitglied der Afghan Pen Association und initiierte die Hashtag-Kampagnen #IchUndDieSchwangerschaft und #WieHeißeIch. Seit ihrer Kindheit migrierte sie in verschiedene Länder. Sie arbeitet als PR-Referentin beim YAAR e. V., einer afghanischen NGO in Berlin.
17:00
„Totalität“ – Alex Struwe
Totalität beschreibt das Problem, ob und wie es überhaupt möglich ist, Gesellschaft als Ganze zu begreifen. Mit dem »Ende der großen Erzählungen« schien sich diese Frage erübrigt zu haben. Aber in der multiplen Krise, Klimakatastrophe und dem globalen Erstarken der Rechten kehrt die Notwendigkeit wieder, den Zusammenhang des Ganzen zu bestimmen. Mit Kapitalismuskritik, Klassenanalyse und Gesellschaftstheorie kommt auch das verdrängte Problem der Totalität zurück.
Aktuelle Theorien müssen diese Leerstelle der Totalität nun füllen. Vom Populismusbegriff zur Neuen Klassenpolitik über die Wiederentdeckung der Kritischen Theorie, des Autoritarismus bis zur Geschichtsphilosophie wird zwar wieder über Struktur und das Ganze der Gesellschaft spekuliert. Aber diese Bestimmungen bleiben notwendig abstrakt – und damit Teil des Problems.
Ist Totalität also immer eine schlechte Verallgemeinerung oder gibt es sie in Wirklichkeit?
Alex Struwe spürt dieser Frage in seinem Buch „Totalität“ nach. In seinem Vortrag erklärt er, warum es trotz aller Schwierigkeiten einen kritischen Begriff der Totalität braucht. Ohne diesen gibt es keinen Einspruch gegen die herrschenden Verhältnisse.
Olga Benario: „Berliner kommunistische Jugend“. – Kristine Listau und Jörg Sundermeier / Verbrecher Verlag
„Es ist bereits halb elf. Jemand schlägt vor, ‚zusammen Eis essen zu gehen!‘ Alle sind einverstanden. Auf der Bergstraße gibt es ein kleines Café, wo eine Portion Eis zehn Pfennig kostet. Dorthin macht sich die ganze Bande auf. Das Eis schmeckt herrlich! […] Doch es konnte auch hier ein Unwetter aufkommen. Der Caféinhaber bezahlte seine Angestellten nämlich nicht nach Tarif! Als wir davon Wind bekamen, entschieden wir, es zu boykottieren. Der Boykott dauerte eine Woche, bis der Unternehmer nachgab, weil er Angst hatte, mit uns seine wichtigsten Kunden zu verlieren. Die Angestellten erhielten den Tariflohn, und wir suchen das Lokal wieder auf.“
Mit 20 Jahren schreibt dies Olga Benario in Moskau, wohin sie nach der aufsehenerregenden Befreiung von Otto Braun geflohen ist. Ihr Buch, das den Alltag der Kommunistischen Jugend Berlins beschreibt, erscheint 1929 in Moskau auf Russisch.
Da es sehr wenig Literatur zur Organisation und Arbeitsweise des KJVD gibt und Olga Benarios Erzählungen über nächtliches Plakatieren, Spendensammlungen oder die Parteibüros so schön wie erkenntnisreich sind, ist dieses Buch ein wichtiges Zeugnis.
Die Verleger:innen des Verbrecher Verlags Kristine Listau und Jörg Sundermeier erzählen von Olga Benarios Leben auf Grundlage der von ihrer Tochter Anita Leocádia Prestes herausgegebenen biografischen Annäherung und stellen ihre nicht selten selbstironische Berichte über politische Arbeit der Arbeiter:innenjugend der 1920er vor.
19:00
Georg K. Glaser: „Geheimnis und Gewalt“. – Buchvorstellung und Lesung mit Lukas Holfeld
Der Roman Geheimnis und Gewalt (1951) von Georg K. Glaser (1910-1995) ist ein atemberaubender Lebensbericht. Er handelt vom Aufwachsen in der Weimarer Republik, geprägt von Armut, sozialen Zerwürfnissen und den Verheerungen, die der 1. Weltkrieg in den Menschen und ihren Beziehungen hinterlassen hat. Der Protagonist Valentin Haueisen – in dem sich Glaser selbst erkennen lässt, auch wenn er nicht identisch mit ihm ist – politisiert sich in der Vagabunden- und Wanderbewegung, wird Mitglied in anarchistischen und kommunistischen Jugendgruppen. Als proletarischer Jungschriftsteller nähert er sich der KPD an, in deren Reihen er Widerstand gegen die zur Macht strebenden Nazis organisiert: auch als »Haueisen«, in handfesten Auseinandersetzungen auf der Straße. Der Roman schildert auch die Wirren des 2. Weltkriegs, in denen Haueisen wie Glaser mit der französischen Armee gegen die Deutschen kämpfte. Der »autobiographische Bericht eines Einzelkämpfers« arbeitet sich an den Idealen ab, denen der Protagonist einst folgte. Hinter den Zeilen liegt eine Trauer über den gescheiterten Versuch eines Aufbruchs, der eine umfassende Erneuerung versprach, aber sich in den Widersprüchen seiner Zeit und in Gewaltverhältnissen verstrickte. In dieser Trauer liegt auch eine Enttäuschung gegenüber dem Parteikommunismus, der keine Antworten auf das Phänomen des Nationalsozialismus als Massenbewegung finden konnte oder nur falsche gegeben hat.
Als Mischung aus Vortrag und Lesung soll in der Veranstaltung der Roman vorgestellt und ein paar Thesen zur Diskussion gestellt werden. Die kommentierte Lesung wird in zwei Teilen á 45 Minuten stattfinden. Zwischen beiden Teilen gibt es eine Pause. Es spricht Lukas Holfeld (Leipzig), der (meist) monatlich die Radiosendung Wutpilger-Streifzüge produziert, die auf verschiedenen freien Radios und im Internet zu hören ist (www.wutpilger.org). Außerdem ist er verantwortlich für das Programm der Veranstaltungsreihe »Kunst, Spektakel & Revolution« in Weimar (www.spektakel.org).
»Paris Mai ’68« · Szenische Lesung und Diskussion mit Hanna Mittelstädt (Einführung) und Alicja Rosinski (Lesung) sowie einem Mitglied der Gruppe in Erwägung
Ende Mai 1968 stand Frankreich kurz vor der Revolution. Zumindest war dies wohl die Einschätzung Präsident de Gaulles, als er per Hubschrauber aus Paris zu geheimen Absprachen mit dem Kommandeur der französischen Streitkräfte in Deutschland flog.
Zuvor war – ausgehend von Universitätsbesetzungen – der erste wilde Generalstreik der Geschichte ausgebrochen. Dieser hielt mehrere Wochen an. Gegen den Widerstand der institutionalisierten Linken und Gewerkschaften.
Herrschende Klasse wie traditionelle Linke waren sich gleichermaßen einig, dass diese Bewegung nicht vorhersehbar war. Nicht eine ökonomische Krise hatte die vorrevolutionäre Situation geschaffen, sondern die Handlungen der Studierenden und Arbeiter:innen eine solche erst herbeigeführt.
Lediglich eine zahlenmäßig kleine Gruppe um die Situationistische Internationale fand in den Ereignissen die Bestätigung ihrer Thesen, welche die Kritik der Entfremdung mit der unbedingten Notwendigkeit des revolutionären Klassenkampfes verbanden. Unter dem scheinbaren sozialen Frieden der Nachkriegsgesellschaft schwelte es: »Wir haben einfach Öl hingebracht, wo Feuer war.«
Auch wenn es der herrschenden Klasse und den Organisationen der alten Linken letztlich im Zusammenspiel aus Repression und Umschmeichelung gelang, das soeben erwachte Proletariat wieder zur Ordnung zu rufen; die Ereignisse dieses Mai ’68 in Frankreich fanden weltweit Widerhall und verkündeten den Beginn einer neuen Epoche von Kämpfen. Vieles ist in die antiautoritäre und antagonistische Linke eingesickert, ohne dass sich heute noch direkt auf dessen Ursprünge berufen wird.
René Viénets hastig verfasstes Buch ist mal Szenenbeschreibung, mal Analyse; vor allem aber großmäulige Ansage an alle Versuche der sich damals schon abzeichnenden Rekuperation. Anhand dieses Zeitdokuments wollen wir an diesem Abend diskutieren und nicht zuletzt die Möglichkeit der Revolution in Erinnerung rufen.
SONNTAG
13:00
„Bis alle frei sind“. Buchvorstellung und Diskussion mit dem Herausgeber*innenkollektiv
2015 kamen Debatten in antifaschistischen Zusammenhängen auf, dass all diese Phänomene Zeichen einer Entwicklung hin zu einem drohenden Faschismus sein könnten. Und zögerlich begannen die Diskussionen, ob und wie und mit wem er aufzuhalten sei. In zahlreichen Zeitschriften und Blogs finden sich seitdem Veröffentlichungen zum Stand antifaschistischer Bewegung, zu Repression gegen Antifas, zu Entwicklungen der extremen Rechten und zur autoritären Zuspitzung staatlicher Politik. Ein nicht unwesentlicher Teil dieser Beiträge dreht sich um die strategische Frage, wie diese Entwicklungen aufzuhalten sind oder ob es darum gehen muss, sich darauf vorzubereiten, was kommt. Für den Doppelband »Bis alle frei sind. Antifa-Debatten 2015–2025« wurden einige Texte ausgewählt und zusammengestellt. So soll der Stand aktueller Antifa-Debatten dokumentiert werden und damit eine Grundlage geschaffen, diese Debatten in die Praxis zu übersetzen.
Auf der Veranstaltung möchten wir einen kurzen Überblick über den Doppelband geben und vor allem mit euch gemeinsam antifaschistische Perspektiven diskutieren.
Ein Gespräch über Peter Weiss’ Roman „Die Ästhetik des Widerstands“ mit dem Übersetzer Joel Scott
Zwischen 1975 und 1981 veröffentlichte Peter Weiss seinen dreibändigen Roman „Die Ästhetik des Widerstands“ in der Bundesrepublik. Kurz nach dem Tod des Autors erschien das Werk 1983 in der DDR. Der Roman zeichnet die Geschichte des antifaschistischen Widerstands zwischen September 1937 und 1945 anhand eines weitverzweigten und internationalen Beziehungsgeflechts nach. Die Handlung beginnt in Berlin mit einem Gespräch zwischen drei befreundeten Antifaschisten. Kurz darauf reist der namenlose Ich-Erzähler nach Spanien, wo er sich den Republikaner*innen im Kampf gegen den Putsch General Francos anschließt. Nach dem Fall der Republik flieht er nach Paris und von dort nach Stockholm. Parallel zur an historischen Ereignissen orientierten Handlung findet eine Auseinandersetzung mit Themen wie Arbeit, Widerstand, Gewalt, Vertreibung, Flucht und Exil statt. Ihre politischen Überzeugungen und Fragen diskutieren die Figuren anhand von Werken aus der bildenden Kunst und Literatur, die sie als Monumente des Kampfs gegen Unterdrückung und Ausbeutung deuten.
Seit 2025 liegt die erste Übersetzung des Romans auf Englisch (The Aesthetics of Resistance) in Gänze vor. Mit einem der Übersetzer Joel Scott unterhalten wir uns darüber, wie es dazu kam, dass „Die Ästhetik“ erst jetzt komplett auf Englisch zugänglich ist. Vor allem aber sprechen wir über den Text und fragen uns, inwiefern Weiss’ Roman noch heute aktuell ist.
15:00
KSR N°9 – Theorie und Kritik der Avantgarde
„Kunst, Spektakel & Revolution“ ist der Titel einer Veranstaltungsreihe in Weimar und eines Magazins, das seit 2010 in unregelmäßigen Abständen erscheint. KSR beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Ästhetik und Gesellschaftskritik und lotet aus, an welchen Punkten in der Geschichte (anti-)künstlerische und revolutionäre Bewegungen ineinander übergingen.
Im Juli erscheint die neunte Printausgabe von KSR – das Heft wird bei der Radical Bookfair erstmals zu erwerben sein. Es beschäftigt sich mit dem Vermächtnis der historischen Avantgarden – also mit jenen Bewegungen, die die Institution der Kunst sprengen wollten, um die Potentiale der Kunst in das Vorhaben einer umfassenden Neugestaltung der Gesellschaft einfließen zu lassen. Diese Strömungen wollten die Wurzeln der Widersprüche des modernen Zeitalters freilegen und entwickelten dabei eine faszinierende Formensprache. Sie erreichten einen erstaunlichen Grad der Reflexion künstlerischer Mittel, formulierten einen heftigen Einspruch gegen den herrschenden Status quo und traten ein für das Neue. Dabei waren die Avantgarden selbst von einer Reihe von Widersprüchen geprägt – so revolutionär sie alle waren, bedeutete dies nicht immer Menschlichkeit in einem emanzipatorischen Sinne. Und ihr Unterfangen ist auf seltsam untote Weise in der Postmoderne präsent, die die Moderne nicht überwunden hat.
Auf der Radical Bookfair sollen einige Thesen zur Avantgarde zur Diskussion gestellt und der Inhalt der KSR N°9 vorgestellt werden.
»Klima und Kapitalismus. Plädoyer für einen ökologischen Sozialismus«
Wie die Linke auf die Klimakrise politisch reagieren soll und welche theoretische Analyse dafür notwendig ist, ist heftig umstritten. In der Klimabewegung rufen viele dazu auf, sich an den einschlägigen Expert*innen zu orientieren. Andere wiederum sehen in ökologischen Fragen eher ein ideologisches Steckenpferd privilegierter Mittelschichten und banalisieren die Dramatik des Klimawandels.
Dieser ist inzwischen in vollem Gange: 2024 lag die globale Durchschnittstemperatur erstmals 1,6 Grad Celsius über der Temperatur des vorindustriellen Zeitalters, die magische Marke des Pariser Klimaabkommens von 1,5, Grad wird demnach bald dauerhaft überschritten sein. Doch das fossile Kapital sitzt weiterhin fest im Sattel und die politischen Entwicklungen lassen nicht hoffen, dass sich daran so bald etwas ändern wird. Während die Klimakrise weiter eskaliert, fehlen den Bewohner*innen der am stärksten betroffenen Erdregionen die Mittel, sich ausreichend gegen deren Folgen zu schützen.
In „Klima und Kapitalismus – Plädoyer für einen ökologischen Sozialismus“ betten die Autor*innen naturwissenschaftliche Erkenntnisse über den Klimawandel in eine marxistische Kritik der kapitalistischen Produktionsweise ein und begründen daraus ein Plädoyer für einen ökologischen Sozialismus: eine Gesellschaft, in der über das Wie und Was der Produktion demokratisch entschieden wird und menschliche Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Nur unter diesen Bedingungen können die drängenden ökologischen Fragen der Gegenwart wirklich angegangen werden.
17:00
„Um der Hoffnungslosen willen ist uns die Hoffnung gegeben“ – Lesung zu Leben und Widerstand von Lisa Fittko von der Initiative Fittko lesen
„Seit heute also herrschte in Deutschland der offene Faschismus. Wir waren darauf vorbereitet gewesen, wir sahen deutlich die Gefahr, alles hatte darauf hingewiesen. Gestern noch hatten wir im Lustgarten mit hunderttausend Berlinern gegen den drohenden Faschismus demonstriert.“ Die Wucht der Gewalt und Verfolgung, die mit dem Nationalsozialismus einsetzte, zerschlug in kürzester Zeit alle Organisationen des politischen Gegners. Was den Jubel vieler hervorrief, die der Entladung ihrer Gewaltfantasien entgegenfieberten, ließ andere apathisch und hilflos erstarren. Nicht jedoch Lisa Fittko. Als Widerstandskämpferin, Fluchthelferin, Kommunistin und Jüdin war Resignation nie eine Option für sie. Bekannt wurde sie durch ihre Fluchthilfe für den Philosophen Walter Benjamin, gewürdigt wird sie für ihre Unerschrockenheit und ihre Solidarität mit den Bedrängten. Gemeinsam mit ihren Genoss:innen im deutschen Widerstand stellte sie sich entschlossen der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft entgegen und selbst auf ihrer eigenen Flucht half sie hunderten, dem sicheren Tod zu entfliehen. Auch in düstersten Zeiten bewahrte sie ihre Menschlichkeit und Handlungsfähigkeit. Die szenische Lesung begleitet Lisa auf verschiedenen Stationen des Widerstands. In den Anfangsjahren in Berlin, bei ihrer Flucht und Internierung in Frankreich, auf ihrer Fluchtroute über die Pyrenäen, die Hunderten das Leben rettete, und schließlich bei der Rettung ihrer eigenen Familie vor der Deportation. Die ca. 90minütige mehrstimmige Lesung wird unterstützt von Visualisierungen, die uns in Raum und Zeit orientieren.
„Arbeit in der Kritischen Theorie. Zur Rekonstruktion eines Begriffs„, Buchvorstellung und Lesung mit Felix Gnisa und den Herausgeber*innen Kimey Pflücke und Philipp Lorig
Arbeit ist in der Theorie der Frankfurter Schule zugleich zentral und randständig in ihrer Bedeutung: Zentral, da die Arbeiter:innenbewegung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts ihren Ausgangspunkt darstellt. Marginal, da die Autoren des Instituts für Sozialforschung Arbeit nicht ins Zentrum ihrer Theoriebildung stellten. Selbst dort, wo Theodor W. Adorno, Max Horkheimer oder Erich Fromm unmittelbar auf die Kritik der politischen Ökonomie von Karl Marx auf bauen, kommt es nicht zu einer systematischen Analyse von Arbeitsverhältnissen. Dennoch ist die kapitalistische Gesellschaft Gegenstand ihrer Analysen, und deren Umwälzung Ziel ihrer Kritik. Damit haben sie heutigen sozialwissenschaftlichen, philosophischen oder feuilletonistischen Debatten um die Arbeitsgesellschaft etwas voraus.
Den Arbeitsbegriff der Kritischen Theorie rekonstruiert der Sammelband in kuratierten Beiträgen, die sich der Arbeitsweise des Instituts, den Schriften der einzelnen Mitglieder und angrenzender kritischer Theoretiker und Theoretikerinnen widmen. Entlang der Konzepte Naturbeherrschung, Entfremdung und Verdinglichung lassen sich die Artikel, Essays und Interviews verknüpfen zu einer Rekonstruktion kritischer Arbeitsforschung heute.